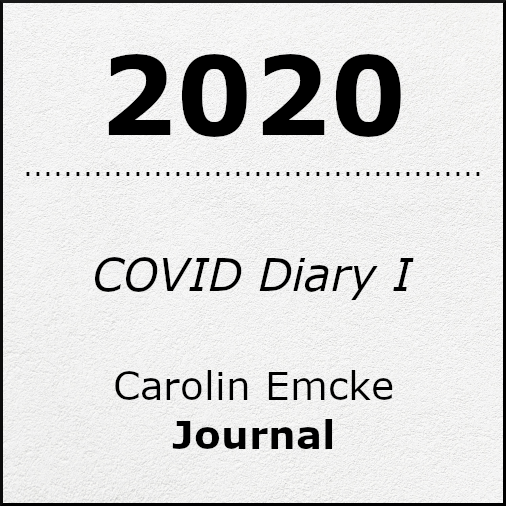Schnitzlers 1928 erschienener Roman geht auf eine bereits 1892 veröffentlichte psychologische Novelle „Der Sohn. Aus den Papieren eines Arztes“ zurück. Seit Anfang der zwanziger Jahre nimmt er diese Idee wieder auf und arbeitet, so brieflich gegenüber Hofmannsthal, an einem „Roman (der richtiger eine Chronik zu nennen sein wird)“. Die Rezeption ist überwiegend positiv und auch die Form wird durchaus bemerkt: Thomas Mann nennt Therese einen Roman, „der wie alle guten und wichtigen heute, keiner mehr ist“, Hugo von Hofamnnsthal betont, dass gerade das „was dem stumpfen Leser monoton scheinen könnte, daß sich sozusagen die Figur des Erlebnisses bis zur beabsichtigten Unzählbarkeit wiederholt, das hat Ihnen ermöglicht Ihre rhythmische Kraft bis zum Zauberhaften zu entfalten“.
Ein Frauenleben hat keine Geschichte – jedenfalls nicht für eine junge Frau, die in der bürgerlichen Gesellschaft ohne Familie, ohne Ehemann, ohne Besitz leben muss und deren Stellung immer nur eine prekäre Anstellung ist. Ihre Lebensgeschichte verliert Zusammenhang und Richtung, sie hat keine Entwicklung und nicht ein mal ein tragisches Scheitern, sondern erschöpft sich, verlischt vielleicht irgendwann.
Es beginnt schon nicht gut für Therese. Ihre Mutter, eine Unterhaltungsschriftstellerin spricht unbestimmt vom „Dulderlos der Frau“, ohne dass die jugendliche Tochter versteht, was damit gemeint ist. Überhaupt versteht man sich in der von Geldsorgen geplagten Familie wenig und streitet viel, das Leben ist ereignislos und doch von kleinlichem Ärger vergiftetet. Auch mit ihrer Jugendliebe bleibt es irgendwie schal, nach schönen Momenten bleibt Therese der Eindruck „daß es heute abend doch nicht das Rechte gewesen war“. Als ihre Mutter sie mit einem Grafen verkuppeln will, geht sie allein nach Wien, arbeitet dort als Erzieherin, später als Privatlehrerin in immer neuen Stellungen. Sie findet ein Auskommen, bleibt aber ein Grenzfall: Anders als die Dienstmädchen gehört sie zur Familie, speist mit der Herrschaft, wird gerne von ihr ins Vertrauen gezogen – aber stets nur bis auf Widerruf, bis man sie wieder los sein möchte.
Männer wollen etwas von ihr, manchen gibt sie sich hin, immer wieder gibt es Enttäuschungen. Mal sind es Offiziere, die sich mit ihr nur unterhalten und die sie belügen, mal ihre Arbeitgeber und deren Söhne, die sie bedrängen, mal auch arriviertere Herren mit ernsteren Absichten, die aber doch letztlich so distanziert bleiben, dass beide Seiten am Ende erleichtert sind, wenn es wieder auseinandergeht. Von einem Seelenverwandten, dem Künstler Kasimir, wird sie schwanger – und dieser verschwindet. Sie versucht das Kind abzutreiben, bekommt es schließlich doch, jetzt gibt es Momente des Glücks für Therese, aber noch mehr Verbitterung – dass sie ihr eigenes Kind nicht sieht, aber fremde Kinder erzieht, immer wieder andere, immer wieder neue. So zieht sich das Leben dahin:
Therese fragte nicht mehr, sie ließ alles geschehen, sie war müde. Es gab Stunden, in denen sie sich ohne jeden Schmerz mit ihrem Leben am Ende fühlte. Sie war kaum dreiunddreißig Jahre alt, doch wenn sie in den Spiegel sah, besonders des Morgens, gleich nach dem Erwachen, fühlte sie, daß sie um Jahre älter aussah als sie war. Solange ihre tiefe Mattigkeit andauerte, nahm sie das ruhig hin. Doch als der Frühling wieder kam und sie sich frischer werden fühlte, lehnte sie sich auf, ohne recht zu wissen, gegen was. i
Wieder einmal geht es bergauf, wieder einmal gibt es Hoffnung, diesmal ist es Herr Wohlschein, einer ihrer Dienstherren, der ihr die Ehe verspricht, natürlich gegen den Willen seiner Verwandtschaft. Therese zögert, sie hat schon so viele Erfahrungen gemacht, aber sie lässt sich noch einmal darauf ein, die Hochzeit wird für Pfingsten angesetzt. Eines Morgens erscheint Herr Wohlschein nicht, Therese erhält keine Nachricht, erst auf Nachfrage erfährt sie, er sei plötzlich verstorben, bei der Totenwache wird sie dann schon wieder als „langjährige Lehrerin der Nichte“ vorgestellt – und sie geht, wieder in die nächste Stellung: „Daß jemand starb, das war am Ende nur eine jener hundert Arten unter denen einer verschwindet der sich davonstiehlt. Es waren so viele tot für sie, Gestorbene und Lebendige“.
Einige Tage später ...
Erzählt wird das alles in 160 meist kurzen Kapiteln, die oft mit einer Zeitangabe beginnen: „Am nächsten Tag …“, „Wenige Wochen später …“, „Im September …“ „Als wieder Frühling war …“. Wieder und wieder geschieht, was nicht mal wirklich Ereignisse sind, eher Vorfälle, Wiederholungen, Enttäuschungen. Lakonisch werden sie verzeichnet, immer aus der Perspektive von Therese – manchmal mit leichter Hoffnung, niemals mit Wissen um die Zukunft -, fast nie mit ihrer Stimme. Mitunter werden in wenigen Sätzen gleich mehrere Familien porträtiert, mit ihren Brüchen und Abgründen:
In ihrer nächsten Stellung bei einer Witwe mit zwei Kindern behandelte man sie wie einen Dienstboten, in einer dritten war es die unleidliche Unreinlichkeit der Umgebung in einer vierten die freche Zudringlichkeit des Hausherren, die Therese bald wieder vertrieb. So wechselte die Stellung noch einige Male, nicht ohne zu fühlen, daß zuweilen ihre eigene Ungeduld, ein gewisser Hochmut, der wie anfallsweise über sie kam, eine selbst unerwartete Gleichgültigkeit gegenüber den Kindern, die ihrer Obhut anvertraut waren, Mitschuld an ihrer Unfähigkeit trugen, sich unter einem fremden Dache einzuleben. ii
So entsteht ein Bild einer untergehenden Gesellschaft aus der Perspektive einer, die zunehmend ausgeschlossen wird, die ohne Drama und Melodrama Schritt für Schritt an den Rand gedrängt wird, sich auch in diesem Rand einrichtet, nur um dort wieder „Einige Wochen später …“ erneut einen weiteren Schritt abwärts machen zu müssen.
Nur in seltenen Momenten gibt die Erzählung ihre Distanz auf. Als Therese ihr Kind zur Welt bringt, ist sie verzweifelt und glaubt, es sei „das Beste wenn sie zugrunde ginge, - sie und das Kind und mit ihr die ganze Welt“. Aber es ist dann doch eine Geburt, ein Ereignis, schmerzhaft und bewusstseinsraubend, aber doch etwas, was vollbracht wird: „Die Erlösung war da.“ Im nächsten Kapitel liegt sie im Bett, phantasiert, dass das Kind tot ist, dass sie auch sterben will, und wir hören hier einmal sich selbst:
‚Was willst du in der Welt?‘ sprach sie in der Tiefe ihres Herzens zu dem leise wimmernden, verrunzelten Geschöpf […] „Was sollst du ohne Vater und Mutter auf der Welt du was soll ich mit dir . Es ist gut, daß du gleich sterben wirst […] Was soll ich denn jetzt mit Dir? Soll ich mit dir in der Welt herumziehen? […] Ich deck‘ dich gut zu, daß dir nichts weh tun wird. Da unter dem Kissen schläft sich´s gut, stirbt sich´s gut. Noch ein Kissen, daß dir wärmer wird … Adieu mein Kind. […]. Du darfst nicht leben. Ich bin ja für andere Kinder da. Ich hab‘ keine Zeit für dich. Gute Nacht, gute Nacht …
Sie wachte auf wie aus einem furchtbaren Traum. […] Und da lag das Kind. Mit weit offenen Augen lag es da, verzog die Lippen, die Nasenflügel, bewegte die Finger und nieste. Therese atmete tief fühlte sich lächeln und hatte Tränen im Aug‘. […] Mein Kind, fühlte Terese, mein Kind! Es lebt, lebt, lebt! iii
Das Kind wird leben und Therese wird weiterleben, aber eine eigentliche Wendung für ihr Leben wird das nicht – oder erst viel später.
Schließt sich ein Kreis?
Nur ganz am Schluss des Textes blitzt etwas wie ein Zusammenhang auf, nicht mehr in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit, die für Therese immer wichtiger wird:
Es fiel ihr heute so viel aus vergangenen Zeiten ein: viele Menschen, deren sie längst nicht mehr gedacht, die sie völlig vergessen zu haben glaubte, Familien, in denen sie gelebt, Väter, Mütter, die Kinder, die sie erzogen oder wenigstens unterrichtet, gleichgültige und allzu sehr geliebte; - es war, als wenn sie ein Album mit Photographien aufblätterte [….]. Und es war traurig und doch auch beruhigend zu denken, daß von all diesen Kindern […] kaum eines heute sich ihrer noch erinnerte und keines vielleicht von ihrer jetzigen Existenz etwas wußte. iv
Auch das ist bitter, Erinnern an ein Vergessen-worden-Sein, es ist aber auch eine Art von Trost in einem Leben, das zuletzt immer schwieriger wird. Wohlschein ist tot, Therese hat ein wenig Geld geerbt, aber ihr Sohn Franz, inzwischen herangewachsen und in die Wiener Halbwelt geraten, erpresst sie immer wieder. Und zum Erinnern gehört auch, dass sie eine „geheimnisvolle, verborgene Schuld“ spürt, „die zuweilen nur flackernd in der Seele aufleuchtet und gleich wieder verlischt“: „Und nach langer, langer Zeit dachte sie wieder einmal einer fernen Nacht, da sie ihren Sohn geboren und umgebracht hatte. Dieser Tote aber gespensterte immer noch in der Welt herum.“
Es ist dieses Gespenst und jene Schuld, die dann die Geschichte zu Ende bringt: Wieder einmal, „Eines Abends im Mai“, kommt Franz zu ihr, lässt sich nicht abweisen. Als sie um Hilfe schreit, erstickt er sie fast und bricht ihr den Kehlkopfknorpel, sie wird daran sterben. Aber es schließt sich doch der Kreis für sie und die Geschichte macht plötzlich Sinn:
Was sich in jener fernen Nacht ereignet und was doch nicht Ereignis geworden war – was sie zu tun begonnen und doch nicht bis zu Ende getan – woran ihr Wunsch mehr gewirkt hatte als ihr Wille – wessen sie immer wieder erinnert und was sie doch nie ins Gedächtnis zu rufen gewagt hatte; - die Stunde – vielleicht war es nur ein Augenblick gewesen - , in dem sie Mörderin gewesen war, lebte mit so völliger Klarheit wieder in ihr auf, daß sie sie fast wie etwas Gegenwärtiges erlebte. v
Die Mörderin wird ermordet – das war übrigens der Plot der Novelle gewesen, aus dem der Roman hervorging: eine typische psychologische Erklärung, warum eine vom Sohn ermordete Mutter diesen noch entschuldigte, die sich aber für das Leben der Mörderin jenseits von Geburt und Tod wenig interessierte. In Therese wir dieser Moment auffällig ambig erzählt – war sie Mörderin gewesen? – war sie es wirklich? – war es Wunsch? – war es eine Stunde? – ein Augenblick? Hier stellt sich etwas wie ein Fatum ein und wird doch zugleich auch schon wieder aufgebrochen, durch die Syntax, durch ein Ungleichgewicht, das dieses ganze Immer-Weiter des Lebens an die eine Stunde, den einen Augenblick hängen möchte.
Therese versucht ihren Sohn zu entschuldigen, mit ihren letzten Worten betont sie, „daß sie den Sohn, der ihr so lange ein Verlorener gewesen war, gleichsam wiedergefunden, in dem Augenblick, da er zum Vollstrecker einer ewigen Gerechtigkeit geworden war“. Aber, so der Epilog, das Gericht mag an den Zusammenhang nicht glauben, man verzichtet darauf, einen Sachverständigen zu bestellen, zumal man ja gar nicht wisse, ob man dazu einen Arzt, einen Priester oder einen Philosophen fragen müsste. Und wir, die Leser, mögen auch nicht wirklich an eine „ewige Gerechtigkeit“ glauben, die in den letzten Seiten in Ein Frauenleben – mehrdeutig ist der Titel: dieses, irgendein, jedes Frauenleben – hereinbricht. Nein, hier schließt sich kein Kreis, im Gegenteil, es ist nicht ohne Ironie, wie sehr dieses Ereignis mit dem Leben kontrastiert, das es mehr abbricht als an ein Ende bringt.
i Arthur Schnitzler. Therese. Chronik eines Frauenlebens, Frankfurt a.M. 2004, 212.
ii Ebd. 54f.
iii Ebd. 110f
iv Ebd. 235.
v Ebd. 302