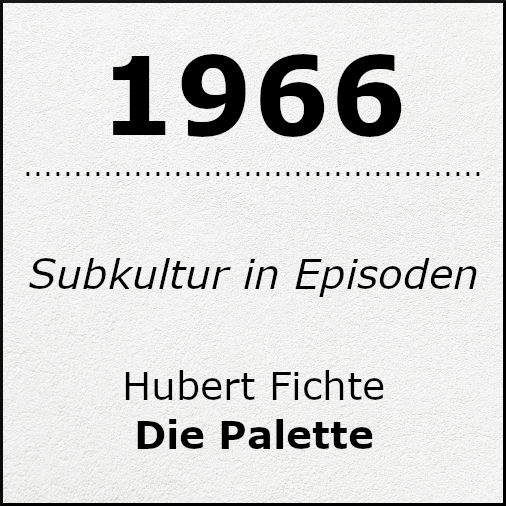Wer in die Suchmaske einer der großen Online-Buchhandlungen ‚COVID-19-Pandemie‘ eingibt, wird mit einem unübersichtlichen Angebot unterschiedlichster Texte konfrontiert: Von (medizin-)wissenschaftlichen Arbeiten über politische Analysen, soziologische Zeitdiagnostiken und historische Einordnungsversuche bis hin zu diversen (pseudowissenschaftlichen) Ratgebern oder Verschwörungstheorien. Daneben sind auch literarische Versuche entstanden, den medizinischen, geschäftlichen, politischen, kulturellen Ausnahmezustand zu dokumentieren. Auffällig ist die große Anzahl an Tagebüchern und Journalen, die während der Pandemie entstehen.
In der Covid-Pandemie erleben diaristische Schreibweisen eine signifikante Konjunktur. Als Medium individueller Lebensaufzeichnung folgt das Tagebuch einer strengen tagtäglichen Zeitlogik, die im globalen Ausnahmezustand aus den Fugen gerät. Das Tagebuch eignet sich deshalb besonders gut, die Krise individueller und gesellschaftlicher Zeitordnungen zu dokumentieren, erfahrbar und reflektierbar zu machen. Digital publizierte Tagebücher erlauben es außerdem, prompt in Debatten einzugreifen oder politisch zu intervenieren.
Schwellen – Zeit – Texte
„Was soll das Schreiben in Form einer Chronik“, so fragt sich Carolin Emcke in ihrem Tagebuch in Zeiten der Pandemie, „wenn doch diese Pandemie gerade das Asynchrone, Ungleichzeitige vorführt.“ i Die Erfahrung asynchroner Zeitverläufe, die hier die Chancen einer synchronen literarischen Aufzeichnung in Frage stellt, spielte in der Pandemie vielfach eine entscheidende Rolle. An den teilweise gegenläufigen Dynamiken von Latenz-/Inkubationszeit, seriellen Intervallen, Quarantäne, Lockdown oder Superspreading-Ereignissen hat der für das moderne Zeitempfinden so wirkmächtige Topos von der ‚Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen‘ eine ungeahnte virologische Aktualität erfahren. Reproduktionszahlen, die wir auf den täglichen Pressekonferenzen des RKI erwarteten, beschrieben einen Zustand vergangener Tage, der medizinische Maßnahmen und politische Entscheidungen der Gegenwart begründete, deren mögliche Wirksamkeit wir aber erst in den folgenden Tagen an Zahlen ablesen konnten, die wiederum auf die dann bereits vergangene Gegenwart verwiesen. Die ungeübte Interpretation von Daten, Grafiken und Statistiken verlangte von uns, ständig zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin und her zu pendeln. Genauso wie das Wissen über das Virus vorläufig bleibt, muss aber auch der Versuch, die Ereignisse literarisch zu verarbeiten, provisorisch bleiben:
Ein Journal wie dieses wird auch ein Journal der Fehleinschätzungen sein, der falschen Töne und Begriffe, das wird sich erst nachträglich zeigen, es kann nur die sich verändernde Zeit und mein Nachdenken darin bezeugen. Das Schreiben hilft. Ohne Sprache, ohne das Schreiben fühle ich mich wie ein Obdachloser ohne Heimat. ii
Die Erfahrung mit den teilweise sehr kurzen Halbwertszeiten von Informationen, Wissen oder politischen Entscheidungen hat gezeigt, dass die Corona-Krise vor allem ein permanent auf Unvorhergesehenes ausgerichtetes Zeit-Management erforderte. Dabei wurde die Aufmerksamkeitsökonomie nicht unerheblich von den zahlreichen Live-Tickern bestimmt, die in einer Dringlichkeit minütlich aktualisiert werden wollten, damit die eigene Wissens- und Informationsverarbeitung mit der Geschwindigkeit neuer medizinischer Maßnahmen und politischer Debatten auch nur einigermaßen Schritt halten konnte.
Strategin der Zeit zwischen privater Lebenswelt und globaler Zeitgeschichte
Diarist:innen sind bereits qua Medium Strateg:innen der Zeit, denn sie werden von dem Takt des ‚Tag für Tag‘ nicht bloß geprägt, sondern organisieren Erfahrungen in der Zeit, reflektieren Zeitordnungen, entwerfen Gegenmodelle zum linearen Zeitfluss, indem sie sich zwischen verschiedenen Zeitformen bewegen. Das gelingt nicht immer, vor allem nicht, wenn der Tag selbst jegliche Struktur zu verlieren droht. Früh schon muss Emcke das Scheitern der Synchronisierung zwischen Schreiben und Ereignisverlauf konstatieren:
Die Woche beginnt mit einer Lüge. Es mag ein Detail sein, das nicht stimmt, aber es ist eben doch eine Lüge. Ich schreibe dies nicht am Montag, dem 30ten. Montag war gestern. Ich schreibe mit einem Tag Verzögerung, das Schreiben hinkt dem erlebten Tag hinterher wie ein versteiftes Bein, das nachgezogen wird und einen synkopischen Rhythmus erzeugt. Gestern konnte ich nicht. Gestern war bloß stumme Lähmung. Verflogen alle wachsame Konzentration der ersten Wochen, all das hungrige Verstehenwollen der medizinischen, sozialen, politischen Facetten der neuen Wirklichkeit […], all die geistigen Behelfs-Strukturen, die die Strukturlosigkeit des Alltags retouchieren sollten – all das funktionierte nicht mehr. iii
Es ist das tagtägliche Schreiben selbst, mit dem der Tag allmählich eine Struktur zurückerhält. Auch die Frage nach der Bedeutung der Chronik als zeitgeschichtliches Aufzeichnungsverfahren wird von der Diaristin perfomativ, in diesem täglich wiederholten Schreibakt beantwortet: Im Rhythmus des (All-)Täglichen dient das Medium als solches zur Reflexion über vergangene Verhaltensformen sowie neue soziale Gesten und wird genutzt, um über die gesamtgesellschaftlichen Chancen der Modellierung einer anderen, postpandemischen Zeit nachzudenken. In kleinen Alttagspraktiken werden Veränderungen sozialer Austauschbeziehungen beobachtet, ihre sozialen und politische Folgen abgeschätzt. Auffällig ist, wie Emcke bereits in ihrem ersten Tagebucheintrag die Reflexion über Zeit mit einer globalen Perspektive verbindet. Denn der globale Ausnahmezustand regiert zwar bis in den letzten Winkel der Welt, zeitigt aber ganz unterschiedliche Folgen, von demokratischen Verhandlungen über angemessene Schutzvorkehrungen bis zu diktatorischen Maßnahmen oder der Leugnung der Pandemie.
Was ist der Takt der Zeit? […] Es wird unklarer jeden Tag, den wir in diesem Modus der Pandemie leben, denn sie hat ihre eigene Zeitlichkeit, Zeit, das ist die Währung, in der die Modelle der Virologen Hoffnung und Not quantifizieren, Zeit, die wir hier, in der Mitte Europas, nur haben, weil andere sie nicht hatten, Zeit, in der uns die Bilder aus China schon erreichten und die wir lange verstreichen ließen, als ginge uns das nichts an, ignorante Zeit, jetzt bedauerte Zeit, verlorene Zeit, Zeit, in der wir, die wir seit Jahren über die Globalisierung kritisch und unkritisch nachdenken, so getan haben, als gäbe es sie nicht, als sei eine Krankheit in China eine Krankheit in China, als stürben sie dort anders als hier, als seien es andere Körper, andere Lungen […], als gäbe es das noch: geschlossene Räume, als gäbe es sie nicht: wechselseitige Verwundbarkeit, als wäre es nicht das, was human macht. iv
Das Schreiben an der Schwelle zwischen lokaler zu globaler Zeit, zwischen geschlossenen Räumen und globalisierter Welt ist charakteristisch für Emckes Journal. Es handelt sich um eine Aufzeichnungsweise, die große zeitgeschichtliche Zäsuren im lokalen Alltag aufspürt und diese kleine private Lebenswelt wiederum am globalen Maßstab misst. In dieser zeitdiagnostischen Vermessungsarbeit entsteht ein reziprokes Verhältnis zwischen lokalem Ausschnitt und pandemischer Weltlage, die sich mitunter stündlich verändert. Begriffe wie Unmittelbarkeit, Anschaulichkeit oder Authentizität, mit denen diaristische Schreibweisen oftmals assoziiert werden, taugen kaum zur Beschreibung dieser Schreibweisen. Stattdessen kommt in Emckes Tagebuch ein für moderne literarische Chronistiken zentrale Eigenschaft zum Tragen: Solche Texte sind häufig topisch organisiert, indem sie zeitgeschichtliches Geschehen mit der Geschichte eines Ortes, einer Institution, einer Familie konfrontieren. Emcke vermittelt den mikrokosmischen Alltag mit dem makrokosmischen Ausnahmezustand der Pandemie, indem sie alltägliche Veränderungen in kurzen Episoden berichtet, um sie anschließend zeitgeschichtlich einzuordnen; indem sie Erlebnisse mal nur kurz protokolliert, dann wieder als symptomatische Erfahrungen auf ihre historische Relevanz überprüft. Dabei bleibt ihr Blick nicht alleine auf medizinische Fragen beschränkt. Emcke weitet den Blick aus, reflektiert über häusliche Gewalt gegen Frauen, über unseren Umgang mit Flüchtlingen, Rassismus oder über den Klimawandel. Das Tagebuch dient hier keiner selbstreferentiellen Introspektion, sondern bewegt sich ständig an der Schwelle zwischen öffentlichem Diskurs und privater Lebenswelt.
Arbeit an einer Geschichte der Gegenwart
Diaristische Gegenwartschronistik versucht wie im Falle von Emckes Journal die Zeitgeschichte aufzuschreiben, „während sie noch qualmt“ v. Im komplexen Zeitgefüge der Pandemie beleibt jedoch stets ungewiss, was aus einer späteren historischen Rückschau noch Relevanz behält und was zu einer bloßen Fußnote herabsinkt. In historischer, aber auch in politischer und ethischer Hinsicht ruft das die Figur der literarischen Zeugenschaft auf:
Ich weiß nicht, wie frühere Chronisten in ihren Tagebüchern, Journalen, Cahiers gezweifelt haben, wie ungeschützt sie schreiben dürften, wieviel Unverstandenes, Rohes zulässig wäre, wie frisch, wie eilig, wir irrtümlich, aber auch wie ungezügelt wütend sie sein dürften, wie unsicher sie waren, welche Ereignisse schon im Moment ihres Geschehens als unvergesslich und unverzeihlich galten. vi
[…] frage ich mich, in welchen Bildern, welchen Formen einmal dieser Pandemie gedacht wird? Wie werden wir uns erinnern, woran werden wir uns erinnern wollen, was werden wir leugnen, das es gegeben haben wird, welche Bilder werden zu Ikonen, wessen Erfahrungen werden gewürdigt, wessen nicht, welche Geschichten werden wir erzählen als wären sie wahr? vii
Die Fragen danach, was erzählt wird und wer die Geschichte schreibt, die von fern an Brecht und Benjamin erinnern, spielen sich bei Emcke im Spannungsfeld aus Dokumentation und ersten historischen Deutungsversuchen ab. Bemerkenswert ist das Futur II („das es gegeben haben wird“), das einen Hinweis darauf gibt, wie das Journalschreiben bereits damit beginnt, zukünftige Vergangenheit mit dem täglichen Historisch-Werden der Gegenwart zu konstellieren. Im Rhythmus der täglichen Aufzeichnungen arbeitet Emckes Journal so an einer Geschichte der Gegenwart und wird zugleich selbst zu einem Zeitdokument. Mehrmals wird der Text durch Fotografien, Momentaufnahme des Ausnahmezustandes, unterbrochen, mit denen die Autorin ein vorläufiges Archiv an Erinnerungsbildern zusammenstellt. Die tägliche Arbeit an der Geschichte der Gegenwart wird so auch zur Arbeit an einer zukünftigen Erinnerungsikonographie. In diesem Text-Bild-Gefüge sammelt Emcke Momente der Hilflosigkeit, der Erschöpfung und Einsamkeit, aber auch Augenblicke des Glücks und eine „Chronik der unfreiwilligen Komik“ viii. Momente des persönlichen Glücks der Autorin entstehen paradoxerweise durch die strenge Taktung des Tagebuchschreibens:
Die letzten Wochen des Schreibens an diesem Journal haben für mich etwas wieder zurückerobert, was aus persönlichen und politischen Gründen verloren schien: Autonomie. Eine paradoxale Erfahrung: im Moment des Eingeschlossenseins, der massiven Beschränkung durch das Schreiben an diesem Tagebuch, Woche für Woche, eine besondere Form subjektiver Freiheit zu entdecken. ix
Es ist die Sprache selbst, die solche Freiheiten im Eingeschlossensein gewährt. Durchgehend beobachtet Emcke an kleinen Details, veränderten sozialen Interaktionsformen und zirkulierenden Zeichen, wie sich die Sprache in der Pandemie verändert, neue Wörter und Metaphern hervorbringt, in hektischen Debatten und im Zorn der Querdenker bedrängt wird. „Wenn ich nicht schreibend nachdenken und erzählen kann“, so Emcke, „bin ich schutzlos ausgeliefert […].“x Das Tagebuch ist vor allem der Versuch, tagtäglich die Sprache zurückzuerobern.
i Carolin Emcke: Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie. Frankfurt a.M. 2021, S. 65.
ii Ebd., S. 19.
iii Ebd., S. 33.
iv Ebd., S. 7f.
v Barbara Tuchmann: Wann ereignet sich Geschichte? In. Dies.: In Geschichte denken. Essays. Frankfurt a.M. 1984, S. 31-39, hier: S. 31.
vi Carolin Emcke, Journal, S. 43.
vii Ebd., S. 11.
viii Ebd., S. 105.
ix Ebd., S. 125f.
x Ebd., S. 240.