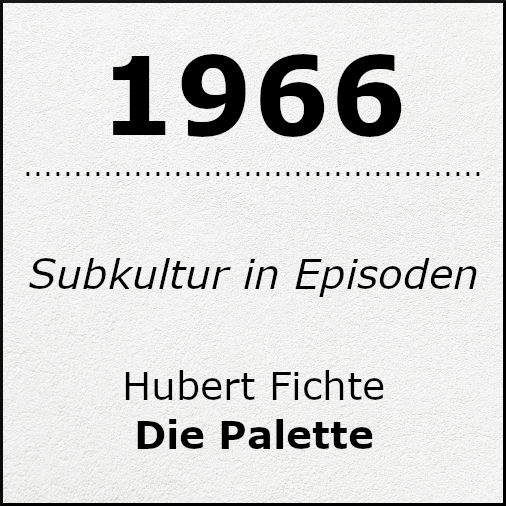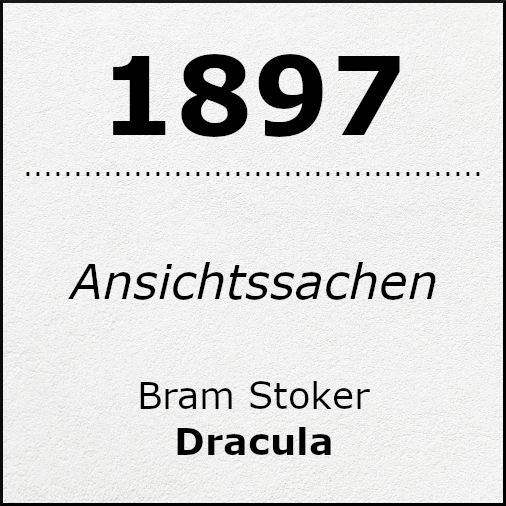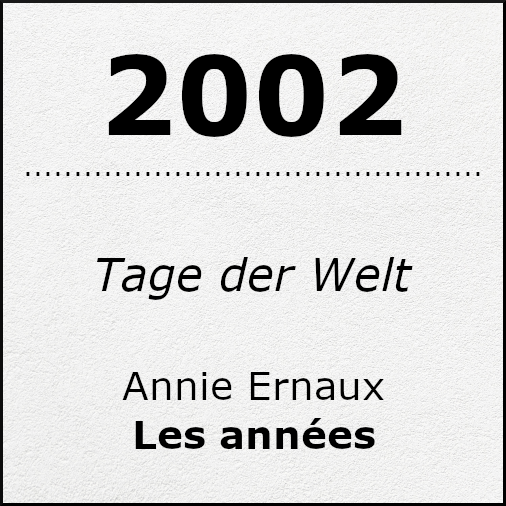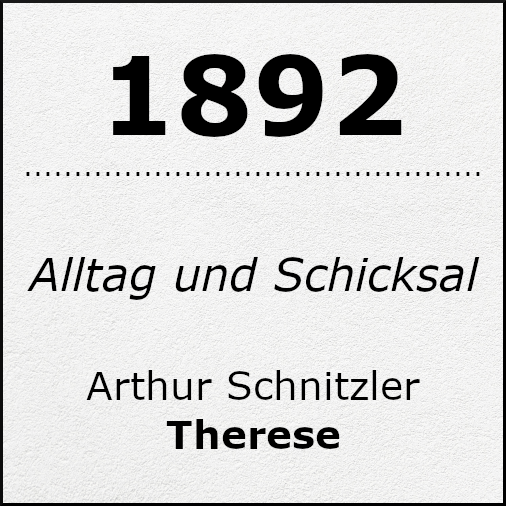Im Jahr 2000 veröffentlicht Alexander Kluge die zwei Bände und 2.036 Seiten umfassende Chronik der Gefühle, die seine literarische Arbeit dokumentiert und erweitert. 2001 bringt er seine zusammen mit Oskar Negt verfassten sozialphilosophischen Schriften unter dem Titel Der unterschätzte Mensch in zwei Bänden und auf 2.270 Seiten neu heraus. Beide Projekte bearbeiten denselben politischen Rohstoff: die Erfahrungen und Gefühle der Menschen im Verhältnis zur Geschichte.
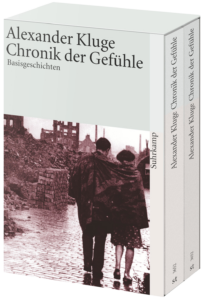
Alexander Kluges Chronik der Gefühle (2000) versammelt seine literarischen Veröffentlichungen der vorangehenden Jahrzehnte und ergänzt diese um hunderte neue Geschichten. Der Titel kann als ein Deutungsangebot für Kluges bisherige Arbeit und zugleich als Ankündigung für die folgende, scheinbar unermüdliche Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart verstanden werden. Diese setzt er seither in unzähligen Fernsehgesprächen, Essayfilmen, Ausstellungsprojekten und über dreißig (!) neuen Buchpublikationen fort.
Der Titel Chronik der Gefühle ist programmatisch aufzufassen. Das betrifft zunächst die Form, die Kluge hier findet und die er in seinen jüngeren Veröffentlichungen weiterentwickelt. Zwar treten Geschichten bei Kluge schon in seinem Debüt Lebensläufe (1962) im Plural auf. Doch wird das Prinzip der Kompilation von vielzähligen kurzen und kürzesten Geschichten zu umso umfangreicheren Büchern erst in der Chronik der Gefühle deutlich. Folgende Publikationen wie etwa Tür an Tür mit einem anderen Leben. 350 neue Geschichten (2006), Das bohren harter Bretter. 133 politische Geschichten (2011) oder Das fünfte Buch. Neue Lebensläufe, 402 Geschichten (2012) – das zeigen ihre Untertitel an – sind von dieser Poetik geprägt. In die Gattungsgeschichte der literarischen Chronik reiht Kluge sich dabei mit Verweisen auf die Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel und Bertolt Brecht oder auf die Form der Anekdote bei Heinrich von Kleist ein[i] und bietet damit zugleich einen sehr pragmatischen Umgang mit seinen dicken Bänden an:
Niemand wird so viele Seiten auf einen Schlag lesen. Es genügt, wenn er, wie bei einem Kalender oder einer CHRONIK, nachprüft, was ihn betrifft. Die subjektive Orientierung: Worauf kann ich vertrauen? Wie kann ich mich schützen? Was muß ich fürchten? Was hält freiwillige Taten zusammen? – das ist die zugrundeliegende Strömung, die sich durch Zeitablauf allein nicht ändert und die wahre Chronik bildet. (CdG I: S. 7)[ii]
Im Vergleich zu den Ereignissen der politischen Geschichte erweisen sich die hier skizzierten Fragen als relativ stabil: Gegenüber jeder neuen Katastrophe lassen sie sich als subjektiver Anspruch artikulieren. Die „wahre Chronik“ ist für Kluge deshalb auch nicht auf der Ebene äußerer Ereignisse wie Kriege, Krönungen oder Ernteausfälle zu verorten. Vielmehr hat sie die Gefühle in ihrem Verhältnis zur Geschichte zu ihrem Gegenstand. Titel wie „Rachegefühl als Freizeitthema“, „Die Gesellschaft als Festung im übertragenen Sinne, darum herum Weidefläche“, „Ein ideologischer Hinweis, der in die falsche Kehle gerät“ oder „Verdachtsarbeit“ können auf Texte über Kriege und Umweltkatastrophen, über Philosophie und Universität, über Arbeit und Liebe u.v.m. verweisen. Durchmessen werden diese Themen immer in einer Perspektive auf den Alltag, der sich um die großen Ereignisse herum abspielt, der in der politischen Geschichtsschreibung in der Regel jedoch keine Aufmerksamkeit bekommt:
Die Gefühle sind die wahren Einwohner der menschlichen Lebensläufe. Von ihnen kann man sagen […]: sie sind überall, man sieht sie nur nicht. Die Gefühle beleben (und bilden) die Institutionen, sie stecken in den Zwangsgesetzen, in den glücklichen Zufällen, agieren an den Horizonten, bewegen sich über diese hinaus bis in die Galaxien. Sie finden sich in allem, was uns angeht. (CdG I: S. 7)
Dabei arbeitet Kluge auf einen Begriff des Gefühls hin, der dieses nicht als passives Sentiment versteht oder als überwältigende Leidenschaft, sondern als ein aktives, subjektives Unterscheidungsvermögen,[iii] das unsere Wirklichkeit auf eine viel grundlegendere Weise konstituiert als uns bewusst ist. Das Anliegen seiner Chronik ist es, diese Gefühle sichtbar und für Erkenntnis und Handeln produktiv zu machen.
Das Politische als Intensität alltäglicher Gefühle
Damit betrifft die im Titel Chronik der Gefühle angekündigte Programmatik auch das Verständnis des Politischen, das Kluge in seinen literarischen, filmischen und sozialphilosophischen Arbeiten verhandelt. Wie Kluge an anderer Stelle erklärt, wenden sich die Menschen „in der Grundströmung ihrer Gefühle“ regelmäßig „von der Wirklichkeit a[b]“.[iv] Dadurch aber können Gefühle auch ein destruktives Eigenleben entwickeln. Die Aufgabe von politischer Autorschaft bestünde deshalb darin, sich „diesen unberechenbaren Unterströmungen“ zuzuwenden, um „in Form von Geschichten das, was als unpolitisch gilt, aber ein Politikum ist, endlich einbringen [zu] helfen.“[v] Wie können die alltäglichen Gefühle politisch werden? Diese Frage wirft Kluge in seiner Rede Das Politische als Intensität alltäglicher Gefühle (1972) auf und es ist zugleich genau die Frage, die er auch mit der Chronik der Gefühle ins Zentrum seiner Poetik und Poetologie stellt.
Für meine Trauerarbeit möchte ich bezahlt werden / Ein kleiner Blumenladen neben uns. Wirklich nette Leute. Immer wenn ich ein kleines Moosröschen kaufen wollte, hat sie mir gleich drei gegeben. Alles für 30 Pfennig. Das hat die aus Sympathie so mitgegeben. Dann hat man ein neues Haus aufgebaut. Alle warteten schon, und eines Tages haben sie das Büdchen mit dem Blumenladen zugemacht. Das ist einfach traurig, wenn die da ausziehen müssen. (CdG II: S. 437)
Im Sinne dieser Frage bezeichnet Kluge die alltäglichen Gefühle in seinem zusammen mit Oskar Negt verfassten Buch Maßverhältnisse des Politischen. 15 Vorschläge zum Unterscheidungsvermögen (1992) als „Rohstoff des Politischen“[vi] und denkt zugleich über die Bedingungen nach, unter denen sie – etwa als Protest – gesellschaftlich eingebracht werden können. Von neuer Relevanz scheint mir dieses Verständnis des Politischen vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen um gesellschaftliche Triggerpunkte (Steffen Mau et al.) und das Phänomen einer so genannten Hyperpolitik (Anton Jäger), die sich in kurzlebigen Schüben der affektiven Mobilisierung niederschlägt, denen jedoch keine nachhaltige politische Organisation oder Institutionalisierung folgt.[vii] Im Dialog mit ihrer zwanzig Jahre zuvor veröffentlichten Studie Öffentlichkeit und Erfahrung (1972) denken nämlich auch Kluge und Negt darüber nach, ob und wie es gelingen kann, den in den Gefühlen verorteten Rohstoff des Politischen nicht in Passivität verfallen zu lassen, sondern in neuen Formen von Gegenöffentlichkeit zu artikulieren und in dauernde politische Organisationsformen zu übersetzen, die an einem Prozess der gesellschaftlichen Emanzipation teilhaben.
Die Chronik zwischen Gefühl und Kontext
Für die Ausbildung einer im Gefühl begründeten und gesellschaftlich wirksam Urteilskraft bietet die Chronik der Gefühle wiederum weitreichendes Material, indem es in Form von Geschichten „Gefäße, Kisten, Röhren, Ampullen“ bereitzustellen versucht, die zur Aufbewahrung menschlicher Erfahrungen dienen sollen: „ein riesiges Lager von Beispielen und Lehrstücken“.[viii] Wer Kluges Geschichten liest, wird allerdings schnell feststellen, dass hier keineswegs von gelingenden Prozessen der Emanzipation erzählt, sondern vielmehr die Inkongruenz von Gefühl und Wirklichkeit vermessen und so das Durchkreuzen subjektiver Handlungsvorsätze durch die Kontingenz geschichtlicher Ereignisse ausgestellt wird. Darin erweist sich Kluge als Realist.
Meier / Jedesmal, wenn er sie verließt, erkrankte er. Aufsteigende Erkältung, von den Bronchien aufwärts in die Nase, zur Stirnhöhle und von dort wieder hinab zu den Bronchien. Sein Wunsch, zurückzukehren: Zerschlagen durch Realitätssinn. Aber er folgte diesem Realitätssinn nicht willig, sondern durchsetzt mit Unfallschäden, z.B. durch Zugluft. (CdG II: S. 157)
Nur aus der Dynamik nämlich zwischen einer Erfahrung des Scheiterns und einem darauf antwortenden Optimismus kann Alexander Kluges Chronik der Gefühle heute – wie schon zum Zeitpunkt ihres Erscheinens – als ein Plädoyer dafür gelesen werden, die mit neuer Gewalt in die Öffentlichkeit vordringenden Gefühle als politischen Rohstoff ernst zu nehmen und sie zu bearbeiten. Zentral ist dafür, Gefühl und Kontext nicht voneinander zu trennen. Andernfalls werden die Gefühle abstrakt und können ihre destruktive Kraft umso stärker entfesseln. Konkret werden die Gefühle nicht, indem man sie benennt, sondern indem man sie erzählt.
[i] Siehe Wolfgang Reichmann: Der Chronist Alexander Kluge. Poetik und Erzählstrategie, Bielefeld 2009.
[ii] Alexander Kluge: Chronik der Gefühle, 2 Bd.: Basisgeschichten, Lebensläufe, Frankfurt am Main 2000. Hier und im Folgenden weise ich diesen Titel mit der jeweiligen Nummer des Bandes in runden Klammern durch die Sigle CdG I resp. CdG II aus.
[iii] Vg. Philipp Ekardt: Toward Fewer Images. The Work of Alexander Kluge, Cambridge (MA, USA) / London 2018, S. 147-165.
[iv] Alexander Kluge: Der Autor als Dompteur oder Gärtner. Rede zum Heinrich-Böll-Preis 1993, in: ders.: Personen und Reden. Lessing – Böll – Huch – Schiller – Adorno – Habermas – Müller – Augstein – Gaus – Schlingensief – Ad me ipsum, Berlin 2012, S. 23-40, hier S. 27.
[v] Ebd., S. 28 und ders.: Das Politische als Intensität alltäglicher Gefühle. Theodor Fontane, in: ders.: Fontane – Kleist – Deutschland – Büchner. Zur Grammatik der Zeit, Berlin 2004, S. 7-19, hier S. 16.
[vi] Oskar Negt / Alexander Kluge: Maßverhältnisse des Politischen. Vorschläge zum Unterscheidungsvermögen, in: dies.: Der unterschätzte Mensch. Gemeinsame Philosophie in zwei Bänden, Bd. 1, Frankfurt a.M. 2001, S. 690-1005, hier S. 721. Hervorhebung im Original.
[vii] Siehe Steffen Mau et al.: Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaf. Warum Gendersternchen und Lastenfahrräder so viele Menschen triggern, Berlin 2023. Anton Jäger: Hyperpolitik. Extreme Politisierung ohne politische Folgen, Berlin 2023.
[viii] Jochen Rack / Alexander Kluge: Erzählen ist die Darstellung von Differenz. Alexander Kluge im Gespräch, in: Neue Rundschau 1 (2001), S. 73-91, hier S. 75.